Marktformen beschreiben die Beziehung zwischen Anbieter und
Nachfrager innerhalb eines spezifischen Marktes. Hierbei wird i.d.R. zwischen
Polypol, Oligopol und Monopol unterschieden.
Polypol
Das Polypol zeichnet sich dadurch aus, dass entweder viele Anbieter, viele Nachfrager oder eine Vielzahl von beidem vorhanden ist. Wenn wir es
lediglich mit vielen Anbietern eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Dienstleistung zu tun haben, sprechen wir von einem Angebots-Polypol. Als Beispiel hierfür wäre etwa der Markt für Cafés in der Innenstadt zu nennen. Angebots-Polypole zeichnen sich außerdem durch eine hohe Substituierbarkeit, also einer hohen Austauschbarkeit aus. Darüber hinaus ist die Marktmacht der Anbieter innerhalb eines Angebots-Polypol meist gering, was darauf zurückzuführen ist, dass sich die vielen Anbieter die vorhandenen Kunden teilen müssen, was die Marktmacht somit einschränkt. Wenn wir es nun aber mit vielen Nachfragern eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Dienstleistung zu tun haben, wird von einem Nachfrage-Polypol gesprochen. Ein Beispiel hierfür wäre nun ein besonders angesagtes Sterne-Lokal, bei welchem die Kunden lange Zeit im Voraus reservieren müssen. Hier kann die Nachfrage nur schwierig befriedigt werden und die Nachfrageseite überwiegt die Angebotsseite. Angebots-Polypole weisen daher einer geringen Substituierbarkeit auf. Darüber hinaus genießen die Anbieter innerhalb eines Nachfrage-Polypols meist eine hohe Marktmacht und können ihre Wunschpreise somit wesentlich einfacher festlegen, da hier nur wenig Konkurrenz vorhanden ist. Im Falle vieler Anbieter und vieler Nachfrager haben wir es schließlich mit einem sogenannten bilateralen Polypol zu tun. Diese Form wird oft als Optimalfall bezeichnet, da hier die Interessen der Nachfrager und die Interessen der Anbieter gleichermaßen befriedigt werden. Ein Beispiel hierfür wäre der Automobilmarkt. Hier haben wir es typischerweise mit vielen Nachfragern zu tun, aber auch mit einem üppigen Angebot, welches in der Lage ist die Nachfrageseite problemlos zu befriedigen. Hier können sich die Nachfrager zwischen einzelnen Anbietern entscheiden und müssen keine enorm langen Wartezeiten einplanen, um ihr Autos erwerben zu können. Das bilaterale Polypol weist folglich eine mittele Substituierbarkeit und eine mittlere Marktmacht auf, da ja beide Seiten ausgeglichen sind.
Oligopol
Ein Oligopol zeichnet sich entweder durch viele Nachfrager und wenig Anbieter; oder durch viele Anbieter und wenig Nachfrager; oder durch
sowohl wenig Nachfrager also auch wenig Anbieter aus. Im ersten Fall, viele Nachfrager und wenig Anbieter, wird von einem Angebots-Oligopol gesprochen. Hierbei stehen beispielsweise viele Musical-Besucher einem beschränkten Angebot aufgrund einer geringen Anzahl an Musicals gegenüber. Hier übersteigt ähnlich wie beim Nachfrage-Polypol die Nachfrageseite die Angebotsseite deutlich. Auch hier ist somit eine geringe Substituierbarkeit bei gleichzeitig hoher Marktmacht der Anbieter zu beobachten. Im Falle vieler Anbieter und nur wenig Nachfrager sprechen wir von einem sogenannten Oligopson. Ein klassisches Beispiel wären Kneipen in der Partymeile außerhalb der Saison. Hier stehen meist nur wenig Nachfrager dem großen Angebot in Form vieler Kneipen gegenüber. Die Substituierbarkeit kann hierbei als hoch eingestuft werden, der Nachfrager hat hier also die Qual der Wahl, während die Marktmacht der einzelnen Kneipen als gering klassifiziert werden kann. Und im Falle von sowohl wenig Nachfrager als auch wenig Anbietern ergibt sich schließlich ein sogenanntes bilaterales Oligopol. Hierbei haben wir es häufig mit Nischenmärkten zu tun, bei denen Nachfrage als auch Angebot relativ begrenzt sind. Ein Beispiel hierfür wäre etwa der Markt hochwertiger Deluxe-Aktenkoffern, welcher durchaus als Nischenmarkt bezeichnet werden kann. Hier haben wir es folglich mit einer geringeren Substituierbarkeit (da ja nur wenig Anbieter solche Artikel anbieten) bei höherer Marktmacht (da ja die Nischenprodukt-Anbieter in ihrer Preisgestaltung relativ frei sind aufgrund der geringen Konkurrenz), zu tun. Das Oligopol weist also hier und da einige Überschneidungen mit dem Polypol auf, sodass eine glasklare Einordnung einzelner Märkte hier nicht immer ohne Probleme möglich ist. Oligopole zeichnet sich jedoch in erster Linie dadurch aus, dass auf mindestens einer Seite (also Angebots oder Nachfrageseite) eine geringe Anzahl zu beobachten ist.
Monopol
Das Monopol kann entweder nur aus einem Anbieter oder nur aus einem Nachfrager bestehen. Im ersten Fall haben wir es mit einem Angebots-Monopol zu tun. Ein Beispiel hierfür wäre etwa der Markt für Weltall-Forschungsraketen innerhalb eines Landes. Hier wird die jeweilige Weltall-Forschungsorganisation meist nur von einem einzigen zertifizierten Anbieter beliefert, welche über die gewünschte Technologie verfügt. Hier ist die Substituierbarkeit folglich gering, während die Marktmacht der Anbieter aufgrund der nicht vorhandenen Konkurrenz hoch ist.
Beim Nachfrage-Monopol haben wir es mit nur einem Nachfrager zu tun. Ein Beispiel wäre etwa in Bezug auf die Fertigung einer Luxus-Unikat-Uhr gegeben, die speziell für einen Kunden nach dessen Wunsch hergestellt wird. Hier haben wir es folglich nur mit einem einzigen Nachfrager zu tun. Das Nachfrage-Monopol weist eine geringe Substituierbarkeit, aufgrund eines limitierten Angebots auf, während die Marktmacht aufgrund eines einzelnen Nachfragers als gering klassifiziert werden kann. Hier muss sich der Anbieter also primär nach den Wünschen des Kunden richten
Gib hier deine Überschrift ein
Gib hier deine Überschrift ein
Gib hier deine Überschrift ein
Quiz Time
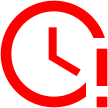
Time's up
Gib hier deine Überschrift ein
Gib hier deine Überschrift ein
About w i r t c o n o m y
Auf diesem Kanal werden regelmäßig Lern- und Erklärvideos zu wirtschaftlichen Themen hochgeladen. Bei wirtconomy wird wirtschaftliches Wissen schnell und kompakt vermittelt und unsere Anwendungsaufgaben helfen dir, dich optimal für bevorstehende Klausuren vorzubereiten